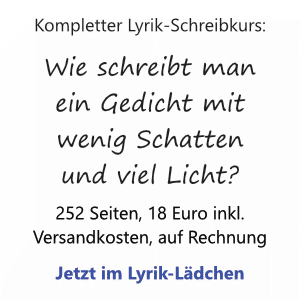Friedrich Wilhelm Wagner: Irrenhaus
Kommentiert von Wilfried Ihrig*
Friedrich Wilhelm Wagner, geboren 1892 in Hennweiler, veröffentlichte seine ersten beiden Gedichtbände bereits 1911/12. Er wurde Mitarbeiter von Franz Pfemferts expressionistischer Zeitschrift Die Aktion in Berlin, mischte später im Züricher Cabaret Pantagruel mit und veröffentlichte in der Literaturzeitschrift Die Ähre und der satirischen Zeitschrift Nebelspalter. 1918 erschien sein dritter Gedichtband und Anfang 1920 der Zyklus Irrenhaus, wenig später Jungfraun platzen männertoll. Noch im selben Jahr kehrte er zurück in die Provinz, wurde Bankangestellter in Kreuznach und gab die Literatur bald völlig auf. Er starb am 22. Juni 1931 in einem Lungensanatorium in Schömberg (Schwarzwald) an Tuberkulose.
Der Zyklus Irrenhaus entstand 1919 aufgrund eigener Erfahrung. Bereits seit 1913 kokainsüchtig, seit etwa 1914 auch morphiumsüchtig, wurde Wagner am 1. November 1918 wegen „Cocainismus“ und „Morphinismus“ in München polizeilich in die Psychiatrische Klinik zwangseingewiesen. Am 13. November erfolgte die Verlegung in die Heil- und Pflegeanstalt Eglfing. Dort blieb Wagner mehr als vier Monate. Die physischen und psychischen Entzugssymptome wurden schwächer, aber erst am 20. März 1919 entließ man ihn als „gebessert“. Wie es in der Heilanstalt und in Wagner aussah, das schildert der Zyklus Irrenhaus.
*Einleitung und Nachwort, Gedichte und Kommentare stammen (mit freundlicher Genehmigung des Autors/Herausgebers) aus: Wilfried Ihrig, Materialien zu Friedrich Wilhelm Wagner, Epubli, Berlin 2023, S. 113ff. Die Gedichte wurden behutsam an die aktuelle Rechtschreibung angepasst. Einleitung, Nachwort und Kommentare sind stark gekürzt wiedergegeben.
I
Friedrich Wilhelm Wagner · 1892-1931
Zwei Weiber, ich, zwei Sanitäter ...
Zwei Weiber, ich, zwei Sanitäter.
Man fährt uns fort wie Missetäter.
Im grünen Wagen.
Ein altes Weib,
Das tobt, ist auf ein Brett geschnallt.
Das andre bäumt den jungen Leib
Und krallt
Sich fest. Man muss es tragen.
Aber im Wagen
Sitzt es still und raucht Zigaretten.
Es erzählt mit koketten
Gesten den Sanitätern,
Es habe ein Kind
Mit sieben Vätern.
Das sei blind - -
- - - -
Wir fahren in das Irrenhaus.
Wir fahren aus der Welt hinaus
Linkadresse zu diesem Gedicht: www.lyrikmond.de/gedichte-thema-4-227.php#2980
Kommentar:
Das erste Gedicht des Zyklus beginnt mit einem dichterischen Paukenschlag. Wer außer Wagner hat gewagt, „Sanitäter“ auf „-täter“ zu reimen? Die Sanitäter werden über den identischen Reim Tätern ähnlicher als die Abtransportierten, bei denen der Vergleich „wie Missetäter“ Abstand schafft. Am Schluss liegt das Irrenhaus außerhalb der Welt, was wohl auch bedeutet, außerhalb des sozialen Raums, in dem man wie ein Mensch behandelt wird.
II
Friedrich Wilhelm Wagner · 1892-1931
Wir kriechen krumm ...
Wir kriechen krumm
Im Kreise stumm
Mit klebenden kleinen
Schritten um
Uns herum –
Dann und wann
Fängt einer an
Zu weinen –
Die Wärter rauchen
Dicke Zigarren.
Breit. Sie brauchen
Nicht zu fragen.
Wir sind Narren.
Wir tragen
Kleider, die nicht passen.
Wir müssen mit uns machen lassen
Linkadresse zu diesem Gedicht: www.lyrikmond.de/gedichte-thema-4-227.php#2981
Kommentar:
Das „Wir“ tritt an die Stelle des „Ich“. Die Insassen bilden eine entindividualisierte Gruppe. Sie sind zu Narren degradiert, die von den Wärtern nicht gefragt werden müssen, ob der Zigarrenrauch stört, oder weshalb einer weint. Die Zeilen werden kurz wie die kleinen Schritte, mit denen sich die sprachlosen Internierten im Kreis bewegen. Aber diese abgehackten Verse haben Reimstruktur, Rhythmen. Ihr Autor hat seine
künstlerischen Fähigkeiten bewahrt.
III
Friedrich Wilhelm Wagner · 1892-1931
Abends beginnen die Kranken zu schreien ...
Abends beginnen die Kranken zu schreien.
Zerbrechen die Betten.
Zerreißen
Mit heißen
Händen die Ketten.
Und speien
Ihr Blut ins Dunkeln,
Wo Wärteraugen giftig funkeln.
Linkadresse zu diesem Gedicht: www.lyrikmond.de/gedichte-thema-4-227.php#2982
Kommentar:
Der Autor macht deutlich, dass er nicht zu den Kranken zählt. Das Schreien dürfte eine Wahrnehmung gewesen sein, aber was folgt, ist eine expressionistische Eruption der darstellerischen Mittel. Die Betten brechen nicht, niemand gelingt es, die Ketten zu zerreißen, nur ist das Schreien derart durchdringend, dass es die Realität übertönen lässt. Vielleicht spucken sie tatsächlich Blut, vielleicht schreien sie sich nur die Seele aus dem Leib. Das doppelte „Zer“, in der Wiederholung verschärft zu „Zerr-“, ist wie eine lautmalerische Beschwörung des Widerstands gegen die Internierung. Wie das Reimschema deutlich macht, ist die vierzeilige zweite Strophe ein Einbruch des Irrealen, der eine ebenfalls vierzeilige Strophe, die reale Ebene des Gedichts, auseinandergesprengt hat.
IV
Friedrich Wilhelm Wagner · 1892-1931
Am Weihnachtsabend ...
Am Weihnachtsabend unterm trauten
Im Saal hochaufgebauten
Sternbesteckten Tannenbaum:
Die Wärter sangen mit lauten
Rauen Stimmen einen Choral.
Die Kranken schauten
Wie im Traum
Mit blöden Blicken sentimental
Auf den Baum.
Plötzlich fing einer an zu pfeifen.
Irgendeine
Melodie.
Und beugte die Knie
Und seine
Hände griffen krampfig ins Leere.
Er lachte und schrie:
„An die Gewehre!“
Lachte
Und packte dabei
Einen der Wärter und warf ihn wider die Wand
Dass es krachte.
Und schlug ihm mit der geballten Hand
Den Schädel zu Brei.
Linkadresse zu diesem Gedicht: www.lyrikmond.de/gedichte-thema-4-227.php#2983
Kommentar:
Ein Gewaltausbruch beendet die verlogene Weihnachtsfeier mit den Wärtern, die singen, als könne man im Irrenhaus Weihnachten feiern, und den Kranken, von denen man nicht genau weiß, ob sie träumen oder wachen. Wieder beginnt die gewalttätige Eruption realistisch, bis eine expressionistische Überzeichnung folgt.
V
Friedrich Wilhelm Wagner · 1892-1931
In der Ecke bei dicken Spinnen ...
In der Ecke bei dicken Spinnen
In blutige Linnen
Gekleidet
Hockt ein Tier.
Das grinst und schneidet
Grause Grimassen.
Und wir
Mit blassen
Blicken hassen
Das Tier.
Linkadresse zu diesem Gedicht: www.lyrikmond.de/gedichte-thema-4-227.php#2984
Kommentar:
Das Tier ist natürlich ein Mensch. Er ist nicht aufrecht, hat keinen aufrechten Gang, er hockt. Er redet nicht, er grinst nur und schneidet Grimassen. Er verhält sich derart, dass selbst die anderen Insassen der Klinik das Wesen nur noch als Tier bezeichnen und „hassen“. Das „leidet“ verbirgt sich in dem mit ironischer Beschönigung gewählten „Gekleidet“, weil da keine Kleider sind, nur „blutige Linnen“.
VI
Friedrich Wilhelm Wagner · 1892-1931
Wer mit uns spricht ...
Wer mit uns spricht,
Sagt immer ja und niemals nein –
Unsere Worte haben kein Gewicht.
Man widerspricht uns nicht.
Man lässt uns König, Hund und Bettler sein.
Man lässt uns schrein.
Man macht ein ganz gleichgültiges Gesicht.
Und manchmal sperrt man einen ein
In eine Kammer, die ist klein
Und rund und hat kein Licht.
Linkadresse zu diesem Gedicht: www.lyrikmond.de/gedichte-thema-4-227.php#2985
Kommentar:
Was die Internierten sagen, ist den Ärzten und Wärtern, vielleicht auch den Besuchern, egal. Manchmal wird die entwürdigende Internierung durch eine Einzelinternierung verschärft. Die letzte Strophe könnte mit „Aber“ anfangen, das „Und“ deutet an, wie unspektakulär die Gummizelle verordnet wird. Das Reimschema ist nicht gerade. Zwei Reime, beide fünfmal verwendet, zwei Zweizeiler und zwei Dreizeiler jeweils mit vertauschtem Reim, am Schluss ein verdoppelter Anfangsreim, die lyrische Form hat das Gewicht, das den Worten der Insassen nicht beigemessen wird.
VII
Friedrich Wilhelm Wagner · 1892-1931
Die Nacht ist nah ...
Die Nacht ist nah. Da nagt die Not.
Eine Glocke klappernd klingt.
Der Wärter bringt
Die Spritze. Die ersehnte Süße
Des Morphiums erfüllt die Füße.
Wir sind tot.
Und im Traume
In die ferne
Stille der Sterne
Getragen
Wir ragen
Ruhig im Raume
Linkadresse zu diesem Gedicht: www.lyrikmond.de/gedichte-thema-4-227.php#2986
Kommentar:
Der Morphinismus war einer der Vorwände, mit denen Wagner psychiatrisch interniert wurde. In der geschlossenen Psychiatrie ist es die Erlösung, anscheinend eine erlaubte Erlösung. Mit der einsetzenden Wirkung endet der erste Teil des Gedichts. Den ersten zwei Zeilen, die wie eine Nervensäge tönen: na-na-na-no und glo-kla-kli, folgt zunächst eine Beschreibung der Beruhigung. Aber die Beruhigten fühlen sich am Ende eines Leidens angekommen, sie schlafen und träumen. Der Traum füllt den zweiten Teil. Er wird zu einem Aufschwung, in einem inneren Kosmos ohne Erdenschwere, ohne Menschen, ohne Klänge, ohne Psychiatrie.
VIII
Friedrich Wilhelm Wagner · 1892-1931
Man hat uns aus der Welt ...
Man hat uns aus der Welt
In das Dunkel gestellt.
Man hat mit Stangen
Uns umgittert,
An denen unser Blick zersplittert.
Unsre Wangen
Sind verwittert.
Unsre Lippen, die einst froh
Sangen,
Sind verbittert.
Rau und roh
Werden die Worte
An dem von Gott verfluchten Orte.
Linkadresse zu diesem Gedicht: www.lyrikmond.de/gedichte-thema-4-227.php#2987
Kommentar:
Die Insassen sind ein eingepferchtes Kollektiv. Der Plural ist nicht der majestatis, es ist ein Plural der Depravierten. Aus der Welt nicht einmal verbannt oder gerissen, einfach nur gestellt wie lästige Gegenstände, wurden sie noch umgittert. Was sie wahrnehmen, ist durch die Gitter entstellt. Die Wangen sind verwittert, nicht durch Wind und Wetter, nur durch die Internierung in Dunkel und Ausweglosigkeit. Der Gesang ist vergangen, die Rede wird rau und roh, wie die Wärter, wäre vielleicht zu ergänzen. Die psychiatrische Anstalt ist nicht einfach nur gottverlassen, sie ist von Gott verflucht.
IX
Friedrich Wilhelm Wagner · 1892-1931
Um 8 Uhr muss man schlafen gehen ...
Um 8 Uhr muss man schlafen gehen.
Doch viele finden
Keinen Schlaf und drehen
Und winden
Weinend sich auf den harten Matratzen.
Einer hat die Gewohnheit zu schmatzen.
Stundenlang. Immer im Takt.
Andere schwatzen.
Und einer, der ist alt und feist,
Hopst splitternackt
Rund um den Saal.
Bis ihn einer der Wärter packt
Und wieder auf die Pritsche schmeißt
Dass es kracht.
In jeder Nacht
Wohl siebenmal.
Linkadresse zu diesem Gedicht: www.lyrikmond.de/gedichte-thema-4-227.php#2988
Kommentar:
Am Anfang steht der Tagesablauf, die zweckrationale, nicht humane Organisation des Arbeitstags. Wenige gesunde Erwachsene wären fähig, um 8 Uhr auf Befehl zu schlafen, das gilt auch für die Insassen. Wenn sie nicht schlafen, stören sie sich gegenseitig, verschärfen sich die Internierung. Im Einzelfall provozieren sie Wärter, die mit Gewalt ruhigstellen, aber die Ruhe der anderen stören.
X
Friedrich Wilhelm Wagner · 1892-1931
Der Christus an der Wand ...
Der Christus an der Wand ist gleich
Einer Blume bleich
Entblüht dem Kot.
Wir lallen lange Litaneien.
Doch jener hört kein Schreien.
Er ist tot.
Wir liegen lallend lang in Reihen
Gekreuzigt auf die harten Betten.
Niemand wird uns retten.
Linkadresse zu diesem Gedicht: www.lyrikmond.de/gedichte-thema-4-227.php#2989
Kommentar:
Priester segneten die Kanonen, Christus segnet die Ketten der Psychiater. Er wird hervorgehoben, er blüht wie eine Blume in einer Latrine und ist doch taub, tot wie Gott. Die Insassen finden sich lang in Reihen wieder, sie liegen gekreuzigt, bewegungsunfähig, fast wie Soldaten im Lazarett. Christus hat Bedeutung nicht als Erlöser, sondern als gekreuzigter Vorläufer.
XI
Friedrich Wilhelm Wagner · 1892-1931
Einer steht den ganzen Tag ...
Einer steht den ganzen Tag
Und wartet, ob man ihm öffnen mag.
In vielen Wochen
Hat er nicht ein Wort gesprochen,
Hat er nicht gelacht.
Und seine Blicke gehen
Tief in die Ferne.
Seine Augen stehen
Versteinte Sterne
In ewiger Nacht.
Linkadresse zu diesem Gedicht: www.lyrikmond.de/gedichte-thema-4-227.php#2991
Kommentar:
Auch in der Entindividualisierung durch die Psychiatrie gibt es Individuen, Einzelschicksale. Was die unverständigen Psychiater als Teil einer Folge von Einzelsymptomen in der Patientenakte festhalten werden, ist für den mitfühlenden Insassen eine logische Folge der Internierung. Einer steht und wartet auf bessere Zeiten, deren Kommen verhindert wird. Er redet nicht, lacht nicht, weshalb sollte er auch. Er nimmt seine Umgebung nicht wahr, seine Augen sind leuchtend blind, versteinte Sterne in ewiger Nacht.
XII
Friedrich Wilhelm Wagner · 1892-1931
Einmal morgens ...
Einmal morgens nach einer langen
Lastenden Nacht –
Weh erwacht
Vom Bette aus
Durch das Fenster sah man zerrissen
Von rostigen Stangen
Ein kleines Stück
Himmlischen Blaus.
Die Kranken krochen aus den Kissen.
Ihre Herzen bebten.
Manche erlebten
Vielleicht ein letztes kleines Glück.
Der Wärter aber hat sie mit Hieben
Zurück
In die höllischen Betten getrieben.
Linkadresse zu diesem Gedicht: www.lyrikmond.de/gedichte-thema-4-227.php#2992
Kommentar:
Die Gedichte sind nicht wie Tagebucheinträge, sondern wie Bruchstücke einer Geschichte, die es nicht als ganze gibt. Einmal, fast wie im Märchen, sehen alle Kranken an einem Morgen etwas himmlisches Blau, von Gitterstangen zerrissen. Das Naturschöne lässt sie aufleben, wie das Schwalbennest in Ernst Tollers Gefängniszelle. Die Gewalt eines einzigen Wärters genügt, um alle zurück in die Betten zu zwingen., ein wenig Freude ist Anlass, die freudlose Ordnung wiederherzustellen.
XIII
Friedrich Wilhelm Wagner · 1892-1931
Wir möchten sterben ...
Wir möchten sterben
Und dürfen nicht.
Wind warf uns an die Wand.
Eine harte Hand
Schlug unser Leben in Scherben.
Man band
Mit Ketten
Uns auf die Betten.
Man will es nicht,
Dass wir sterben.
Wir sollen mit sanftem Gesicht
Im Dunkel verderben.
Linkadresse zu diesem Gedicht: www.lyrikmond.de/gedichte-thema-4-227.php#2993
Kommentar:
Das Leben aller Insassen der Psychiatrie liegt in Scherben, sie dürfen nicht leben, aber auch nicht sterben. Nicht romantische Todessehnsucht lässt sie wünschen, sterben zu können, sondern die pure Verzweiflung. An die Betten gefesselt („Mit Ketten“) sollen sie verderben statt zu sterben. Die drei Zweizeiler wären ein elegisches Gedicht. Die zwei Dreizeiler rekapitulieren die psychiatrische Gewalt, die nichts anderes als Resignation erlaubt.
XIV
Friedrich Wilhelm Wagner · 1892-1931
Die Türme tanzen im Morgen rot ...
Die Türme tanzen im Morgen rot.
Wir schlugen die wandernden Wünsche tot.
Andere Arme schaffen das Werk -
Flut und Flamme. Baum und Berg.
Wir singen das Lied, das seelelos
Stieg aus einem Jungfernschoß.
Gottes graue Greisenhand
Führt uns ins gelobte Land.
Linkadresse zu diesem Gedicht: www.lyrikmond.de/gedichte-thema-4-227.php#2994
Kommentar:
Unerwartet erklingen Reminiszenzen der sozialrevolutionären Dichtung, natürlich nur noch, um die zu Resignation führende Geschichte zu erinnern. „Unser roter Traum zerrinnt“ begann ein früheres Gedicht Wagners, jetzt zerschneidet er den Begriff Morgenrot, um unauffällig das „rot“ zu betonen. Die Insassen der Psychiatrie haben keine lebendigen Wünsche übrig. Aber zumindest er glaubt noch an Andere, natürlich Arme, denen „das Werk“ gelingt, sie bilden den Gegensatz zu den Internierten. Die Insassen der Psychiatrie erwarten für sich nur noch die Erlösung im Jenseits, nicht im Diesseits. Während Wagner in Bayern psychiatrisch interniert war, herrschte in ganz Deutschland die lang erträumte Revolution, nur nicht in den Psychokliniken.
XV
Friedrich Wilhelm Wagner · 1892-1931
Der Traum entrinnt ...
Der Traum entrinnt
Den Händen wie Wind.
Wir gehen
Auf weißen leisen Zehen
In Nacht und Not.
Wir beugen uns dem Gebot.
Wir sind allein.
Der Traum entrinnt.
Und Nebel spinnt
Uns ein –
Bis wir blind
Und gestorben sind.
Linkadresse zu diesem Gedicht: www.lyrikmond.de/gedichte-thema-4-227.php#2995
Kommentar:
Die Wortwahl entsagt der Politik, nicht ohne durch die Worte „Der Traum entrinnt“ noch deutlicher an den zerrinnenden roten Traum zu erinnern. Er wird ungreifbar wie jeder Traum. In der Internierung herrscht das Gebot, kein biblisches, sondern ein weltliches, erlassen von den Göttern in Weiß. Alle Insassen gehen lautlos in „Nacht und Not“ durch den Nebel, das berühmteste Wortspiel (Palindrom) für ein Gegenwort zu Leben, werden vor dem Tode blind.
XVI
Friedrich Wilhelm Wagner · 1892-1931
Wir greifen mit den heißen Händen ...
Wir greifen mit den heißen Händen
Hart in das morgennasse Gras.
Wir stehn zum Sprung und stehn vor Wänden
Und was wir lieben, liegt weit hinter Glas.
Und alle Freude ist uns fremd und fern.
Es bleibt uns nur ein tausendfaches Sterben.
Und unsre Füße schreiten über Scherben.
Ob unsern Stirnen steht kein Stern.
Linkadresse zu diesem Gedicht: www.lyrikmond.de/gedichte-thema-4-227.php#2996
Kommentar:
Wieder greifen die Internierten nach etwas, nach dem morgennassen Gras, vielleicht auf dem Gelände der Anstalt, vielleicht ungreifbar hinter dem Glas der vergitterten Fenster. Freude gäbe es für sie nur draußen, fern der psychiatrischen Klinik, drinnen ist sie fremd, nicht mit dem erduldeten Zwang vereinbar. Auf dem Weg zum Tod schreiten sie über Scherben, vermutlich die Scherben, in die ihr Leben durch die Internierung zerschlagen wurde.
XVII
Friedrich Wilhelm Wagner · 1892-1931
Die Welt liegt weit und weiß ...
Die Welt liegt weit und weiß
Und weich im Schnee.
Die Welt entläuft uns leis
Ein flüchtiges Reh – –
Eine lange Nacht
Steht uns bevor – –
Der Wagen fährt tief in ein dunkles Tor.
Und macht
Jäh halt –
Im Hof der Irrenanstalt.
Linkadresse zu diesem Gedicht: www.lyrikmond.de/gedichte-thema-4-227.php#2997
Kommentar:
Wie eine abendliche Winteridylle wirkt das Gedicht durch die ersten drei zweizeiligen Strophen. Zweimal wird die Welt in neoromantischem Ton charakterisiert, einmal wird die Nacht sachlich angekündigt. Doch die letzte Zeile führt wieder in die Anstalt, wie das erste Gedicht des Zyklus. Man wird die zwei letzten Strophen begreifen dürfen als die Wiederkehr des Alptraums, der mit der Internierung begonnen hat.
XVIII
Friedrich Wilhelm Wagner · 1892-1931
Geräusche rasen ...
Geräusche rasen
Alle Straßen
Strahlend strömen in die Welt.
Gehn ist uns vergällt.
Fuß zerfällt.
Warum hält
Man uns fest –
Warum lässt
Man uns nicht sterben
Und verderben
Wie es uns gefällt –
Linkadresse zu diesem Gedicht: www.lyrikmond.de/gedichte-thema-4-227.php#2998
Kommentar:
Die Form ist untypisch für Wagner. Das Gedicht wirkt fast wie eins aus dem „Sturm“-Kreis, zu dem Wagner nie zählte. Die Geräusche und Straßen sind in der Welt, außerhalb der Internierung. Das Gehen ist den Internierten nicht untersagt, nur vergällt, vermutlich weil es nicht aus der Anstalt führt. Der Fuß zerfällt, weil ungenutzt. Wieder ertönt, zwischen Frage und grübelndem Selbstgespräch formuliert, die Klage, weder sterben noch verderben zu dürfen, obwohl es den Anstaltsinsassen besser gefiele, zu verderben als festgehalten zu werden, in der Entmündigung und Entrechtung durch die Psychiatrie. Die Zeilenzahl ist wieder ungerade, zu drei relativ unauffälligen Reimen wird ein Reim, beginnend mit Welt, wie ein fünfmaliger Schlag gegen die Anstalt gesetzt.
XIX
Friedrich Wilhelm Wagner · 1892-1931
Wir wandern um die Wand ...
Wir wandern um die Wand
Im Kreise immer, krank und krumm.
Wir werden dick, wir werden dumm.
Wir wandern um die Wand herum.
Und Tag für Tag. Den ganzen Tag.
Und einmal, eines Morgens lag
Der eine da, – den traf der Schlag.
Wir andern aber standen stumm.
Wir standen alle wie versteint
Wir wussten, was uns ewig eint,
Und keiner, keiner hat geweint.
Wir wandern um die Wand herum.
Linkadresse zu diesem Gedicht: www.lyrikmond.de/gedichte-thema-4-227.php#2999
Kommentar:
Die Wand ist als Motiv der Mittelpunkt der zerstörerischen Monotonie des Anstaltslebens. Wand ist auch das einzige Wort, auf das sich das Gedicht keinen Reim machen will, er wird durch das „herum“ in der letzten Zeile verhindert. Die Insassen wandern im Kreis um die Wand, nichts ändert sich jemals, außer wenn einer plötzlich stirbt. Aber auch dann gibt es dazu nichts zu sagen, keiner weint, alle nehmen den Rundgang um die Wand wieder auf. Wenn man das Gedicht trivialisieren wollte, könnte man an das Lied „Immer an der Wand lang“ denken. Angemessener wäre, Becketts „Verwaiser“ zu assoziieren.
XX
Friedrich Wilhelm Wagner · 1892-1931
Unser Denken ist zerbrochen ...
Unser Denken ist zerbrochen.
Ein böser Stern
Hat uns ins Gehirn gestochen.
Das war vor manchen Wochen
Meilen fern.
Damals krochen
Wir ins Dunkeln
Vor dem Funkeln
Der Blicke des Herrn.
Aber er hat uns gerochen
Und das Urteil gesprochen.
Und wir sterben gern.
Linkadresse zu diesem Gedicht: www.lyrikmond.de/gedichte-thema-4-227.php#3000
Kommentar:
Das Denken der Anstaltsinsassen ist zerbrochen. Als sie sich verkriechen wollten, hat der Herr sie aufgespürt und über die stummen Namenlosen, die wie im Chor denken, selbst wenn sie ihr Denken verloren geben, das Urteil gesprochen. Und wenn sie auch gern sterben, einer von ihnen hat überlebt und für sie alle gedichtet.
Nachwort:
Grausame Selbsterlebnisse halfen dieses erschütternde Versheft gestalten; an allen Rändern von
Raserei vorüber sind hier Dichtungen an den Abgrund des Nichts gestellt, ist der Bogen über alle Qual in eine große unerhörte Müdigkeit gemündet. F. W. Wagner, dieser Dichter, der mit einem Fuß im Grab, mit dem anderen im Irrenhaus steht, hat in diesen Versen eine furchtbare Anklage gegen die Unmenschlichkeit unserer Irrenhäuser erhoben. Hier wird ein Totschweigen nicht lange gelten: – er muss gehört werden!
(Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, 16. März 1920).
Der Werbetext hat wenig bewirkt. Das Versheft wurde kein Verkaufserfolg und war bald vergessen, was vermutlich auch daran lag, dass Wagner nach 1920 nie wieder ein Buch publiziert hat. Er wurde erst wiederentdeckt, als die Expressionisten wieder populär wurden.
Nach einzelnen Gedichten wurde Irrenhaus als erster großer Nachdruck aus Wagners Lyrik in der Anthologie expressionistischer Phantasien über den Wahnsinn (1980) von Thomas Anz vollständig wiederveröffentlicht.
Zum biographischen Hintergrund des Zyklus: Wagner wurde am 1. November 1918 in München wegen seiner Drogensucht polizeilich veranlasst in die Psychiatrische Klinik eingewiesen. In der Klinikakte, die ich 1990 entdeckt habe, steht für den Tag der Aufnahme unter anderem:
„Patient ist zeitlich und örtlich orientiert. Er gibt geordnet, in etwas überhebendem und blasiertem, manchmal etwas ironisiertem Ton Auskunft, macht einen apathischen, schlaffen Eindruck. Mit seiner Verbringung in eine Heilanstalt ist er ziemlich einverstanden, bloß hat er einige Zweifel, dass er sich das Morphium und Cocain abgewöhnen wird. Das Gedächtnis und die Merkfähigkeit ist gut.“
Der Eintrag vom 12. November lautet: „Patient erhält seit über 8 Tagen kein Morphium mehr. Keine Entziehungsbeschwerung mehr. In sehr schlechtem Ernährungszustand. Patient ist geisteskrank (Morphinismus Cocainismus) und nach Artikel 80 II P.Dt.G.B. in die Anstalt eingewiesen.“
Einen Tag später wurde er in die Heil- und Pflegeanstalt Eglfing „entlassen“ mit der Bemerkung „gebessert“, „arbeitsunfähig“. Das Formular für die Patientenakte enthielt Felder für besonders schwerwiegende Diagnosen und für gerichtliche Strafen. Die Felder blieben leer, Wagner war weder eine Gefahr für sich oder die Umwelt noch vorbestraft. Der aufnehmende Arzt schrieb: „Er antwortet mit gedämpfter Stimme in gleichgültigem Tone. Orientierung ungestört.“
In Eglfing blieb Wagner mehr als vier Monate. Die physischen und psychischen Entzugssymptome wurden schwächer, am 27. Dezember wurde notiert: „Verhält sich dauernd ruhig und geordnet, 'arbeitet' fleißig (Literaturstudien), ist mit seiner augenblicklichen Lage zufrieden. Soll ab heute etwas freier behandelt werden (Hofgang).“
Am 20. März 1919 wurde er als gebessert entlassen.
Nach der Entlassung verfasste er den Zyklus Irrenhaus, falls er nicht schon daran geschrieben hat, als er fleißig „gearbeitet“ hatte. Der Zyklus war bis auf wenige Vorabdrucke neu, durch den selbsterlebten Aufenthalt in der Psychiatrie wie in einer unanfechtbaren Endfassung entstanden. Es ist, als wäre die Erfahrung derart übermächtig gewesen, dass sie unvermittelt ihre dichterische Form erzeugt hat, keine Zeile schreiben ließ, die noch einer größeren Überarbeitung bedurft hätte.
In der expressionistischen Lyrik hatte es bis dahin schon Gedichte zu dem Thema gegeben. Aber wenn expressionistische Lyriker über „Irre“ dichteten, waren die auch nach Meinung der Dichter „geisteskrank“. Die meisten bekannten Gedichte nicht internierter Expressionisten über „Irre“, von Ernst Stadler, Johannes R. Becher, Georg Heym und anderen, berichten distanziert über die Zwangsinternierten, mit „er“ oder dem Plural „sie“. Nur Georg Heym verwendet in seltenen Fällen das „wir“.
Wagner schreibt, wie es den einzelnen Gedichten des Zyklus angemessen ist. In der ersten Zeile des ersten Gedichts verwendet er zum ersten und letzten Mal das Wort „Ich“. Im dritten Gedicht wählt er die Perspektive des Beobachters, der über „die Kranken“ schreibt, aber weiß, dass zumindest er selbst gesund ist. Gelegentlich, zuletzt im elften Gedicht, beschreibt er „einen“, der aus der Reihe tanzt. In den folgenden Gedichten formuliert er nur aus der Perspektive des „wir“, des internierten Kollektivs. Wagner hat die nach der Entlassung wiedergewonnene Redefreiheit nicht nur genutzt, um die umfangreichste expressionistische Dichtung über eine selbsterlittene Internierung in der Psychiatrie zu verfassen, er dichtete über die Erfahrungen eines geistig Gesunden im „Irrenhaus“. Damit hat Friedrich Wilhelm Wagner eines der wichtigsten psychiatriekritischen Werke der deutschen Literatur geschrieben.