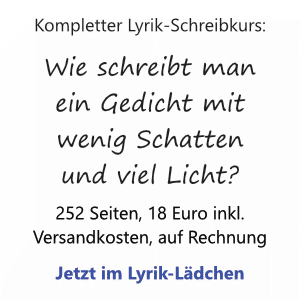Walther von der Vogelweide
Der berühmteste Minnesänger war (und ist) Walther von der Vogelweide (um 1170 – ca. 1230). Dies liegt zum einen an dem Umfang seines überlieferten Werkes, zum anderen beherrscht er nicht nur sämtliche Stilrichtungen des Minnesangs, sondern äußert sich in der sogenannten „Spruchdichtung“ auch als explizit politischer Schriftsteller und mischte sich damit nachdrücklich in die damalige (Herrschafts-)Politik ein.
Was heutige Leser bei ihm aber besonders schätzen mögen, ist, dass er in seinen sogenannten „Mädchenliedern“ die alte „Herzeliebe“ wieder aufgreift, jetzt aber im anspruchsvollen sprachlichen Gewand der fin'amor. Auf diese Weise kommen Texte zustande, die denen der Erlebnislyrik der Klassik, der Lyrik der Romantiker bis hin zum poetischen Realismus um nichts nachstehen und somit dem Fühlen und Denken heutiger Menschen absolut entsprechen.
Die Rechte für die Adaptionen und Anmerkungen zu den Texten liegen wie bei den anderen Mittelalterseiten bei Dieter Effertz. Quelle der Texte Walthers ist Karl Lachmann’s „Walther von der Vogelweide“ (1965).
Die Reinmar-Fehde
Walther begann seine Karriere am Wiener Hof, nicht weil er schon so berühmt war, sondern weil ihn bestimmte Kreise (er selbst spricht einmal von „guten Leuten“) dort haben wollten, als Gegengewicht zu dem offiziellen Hofsänger Reinmar von Hagenau. Reinmar († vor 1210) war Elsässer und dürfte die französische Hoflyrik gut gekannt haben, wobei er sich allerdings bemühte, dem deutschen Geschmack möglichst entgegenzukommen; Walther dagegen war Donauländer und mit der dortigen, eigenständig deutschsprachigen Liedtradition vertraut.
Reinmar besang in vielen Liedern seine Liebe zu einer (wahrscheinlich verheirateten) adeligen Dame. Sehr viele am Wiener Hof nahmen ihm das aber nicht ab, Reinmar beklagt sich:
Ungefüeger schimpf bestêt mich alle tage:
si jehent daz ich ze vil gerede von ir
und diu liebe sî ein lüge diech von ir sage.
(Lachmann 1964: 197.9-11)
Eräuterungen:- bestêt (von bestân/bestên); hier etwa: verfolgt; - jehent (von jehen): sagen; - diech: die ich (Zusammenziehung/Kontraktion)
Reinmar war damals gerade mit seinem Lied „Ich wirbe umb allez ...“ aufgetreten:

Kommentar:
Worterläuterungen
Walther kontert mit einem Lied, zu dem in der Handschrift ausdrücklich bemerkt ist, es sei in dem Ton (Melodie) von „Ich wirbe umb allez daz ein man ...“ zu singen. Höhepunkt seines Liedes ist ausgerechnet eine Frauenstrophe, was einen klaren Verstoß gegen die poetischen Normen der Lieder im Stil der französischen fin'amor darstellt.

Kommentar:
Worterläuterungen
Im folgenden Lied wird deutlich, dass Walther es sich durch den persiflierenden Angriff auf Reinmar mit der Dame verdorben hatte, schließlich hat er sie (in der Frauenstrophe) gewissermaßen benutzt, um Reinmar zu attackieren. Zur Reue bewegt ihn dies aber freilich nicht.

Kommentar:
Man beachte die differenzierende Verwendung von frowen (Vers 1) bzw. wîp (Vers 12). Walther stellt dem asymmetrischen Minnedienstverhältnis der Hohen Minne ein Liebesverhältnis auf Augenhöhe gegenüber.
Worterläuterungen
So bissig der vorherige Text auch erscheinen mag, Walther kann noch einen Zahn zulegen. In einigen seiner Lieder bezichtigt er darüber hinaus die Hohe Minne bloß Panegyrik (hier: Lob der Herrschaften) zu sein, so auch im Folgenden.

Kommentar:
Auch in diesem Gedicht lenkt Walter die Aufmerksamkeit auf das gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis von Herrschaft und Dichter (vgl. Vers 4 und 16).
Worterläuterungen
Nun hatte Walther überzogen: Er musste den Wiener Hof verlassen.
Spruchdichtung
Nach dem Fiasko der Reinmarfehde wandte sich Walther vermehrt der „Spruchdichtung“ zu. In althochdeutscher Zeit waren die Sprüche eine knappe, zweigliedrige Sentenz der Art: „Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein“. So findet man z.B. bei Notker von St. Gallen (um 900): „So daz Rehbockelîn fliehet, so blinket im abur der ars.“ (Braune/Helm: Althochdeutsches Lesebuch, Tübingen 1958, S. 71).
Dreihundert Jahre später sind aus solchen kurzen Sentenzen fast kleine Gedichtstrophen geworden:
Ein wolf sîne sünde flôch,
in ein klôster er sich zôch,
er wolte geistlîchen leben.
dô hiez man in der schâfe pflegen:
sît wart er unstaete.
dô beiz er schâf unde swîn.
er jach, daz ez des pfaffen rüde taete.
Der ältere Spervogel (Spervogel I. oder Herger benannt, um 1180), Lachmann, Minnefrühling, S. 24
Walther entwickelt das Genre der Sprüche zu echten Liedern bzw. Gedichten weiter. Er benutzt die Sprüche in erster Linie, um sich in die Politik („Thronstreit“) einzumischen. So wie wir Walther bisher kennengelernt haben, tritt er dabei sehr selbstbewusst auf und nimmt kein Blatt vor den Mund. In seinem bekanntesten Spruch stellt sich Walther dann auch gleich in der Pose des „Denkers“ dar:

Kommentar:
Dieser Spruch befasst sich mit dem Grundproblem der damaligen christlichen Ritterschaft. Wie ist es möglich, der Welt zu gefallen, ohne Gottes Huld zu verlieren? Walther sieht den Grund für dieses Problem in den herrschenden politischen und sozialen Zuständen. Er übersieht geflissentlich, dass es durch die rigide Moraltheologie im Zuge der Cluniazensischen Reformen unmöglich geworden ist, zumindest was die Minne angeht, diese „driu dinc“ zusammen in einen Schrein zu bekommen. Aber es ist auch zu bedenken, dass solche theologischen Prinzipien im Volke nur sehr langsam rezipiert werden. Sollte Walther dies nicht verstanden haben? Hier dürfen wir nicht vergessen, dass Walthers Spruch keine moralische Belehrung, sondern letztlich politische Propaganda als Beitrag zum Thronstreit zwischen den Staufern* und den Welfen ist.
*„Weiblinger“: Staufer stammten wohl aus Weiblingen bei Stuttgart und „Weiblingen“ war auch ihr Kampfruf
Worterläuterungen
Walther bleibt bei seinen politischen Sprüchen keinesfalls immer so im Allgemeinen, wie es sich in dem vorigen Lied darstellt. Er knöpft sich die politischen Protagonisten auch persönlich vor, und wie wir Walther kennen, begegnet er den hohen Herrschaften keineswegs mit Demut oder Unterwürfigkeit.
Dem Kaiser stellt Walther sich vollmundig folgendermaßen vor:
Hêr keiser, ich bin frônebote
und bringe iu boteschaft von gote …
Den König Philipp belehrt er:
Diu krône ist elter danne der künec Philippes sî ...
Die Fürsten hat er längst durchschaut und sagt ihnen auf den Kopf zu:
Ir fürsten, die des küneges gerne wære âne ...
Bischöfe und Pfaffen ...
Ir bischofe und ir edeln pfaffen sît verleitet.
seht wie iuch der bâbest mit des tievels stricken seitet.[in die Irre führen]
Den Papst attackiert er am heftigsten:

Kommentar:
Worterläuterungen:
• Ahî (Vers 1): Interjektion
• Walhen (Vers 2): Welschen (nicht deutsch Sprechende, sondern eine romanische Sprache)
• giht (Vers 4) von jehen
• wasten (Vers 5): verwüsten
• ie dar under (Vers 6): Während dessen
• kasten (Vers 6): Geldkasten
• stoc (Vers 7): Opferstock
• gement (Vers 7): geführt, gebracht
Es ist nicht immer nur die große Politik, die Walther verarbeitet, sondern mitunter auch ganz einfache private Erlebnisse:

Kommentar:
Worterläuterungen:
• lâze (Vers 6): ver-lassen
• schiltes (Vers 7): schilte sîn; schelten, beklagen
Meister Walther bietet dem Grafen von Katzenellenbogen seine Dienste an. Aber der sagt nein, er habe seine eigenen Musikanten!

Kommentar:
Worterläuterungen:
• ein Pôlân aide ein Riuze (Vers 4): ein Pole oder ein Russe
• mære (Vers 6): Ruhm, Ansehen (vgl. „gute neue mär“)
• snarrenzære (Vers 7): leicht spöttischer Ausdruck für fahrende Musikanten
• hovewerden (Vers 8): höfische Werke
Das Erlebnis Walthers mit dem Bogener könnte man für die Begegnung mit einem skurrilen ewig Gestrigen halten, leider aber ist der Bogener der Vertreter einer neuerlichen kulturellen Wandlung. Nach der Jahrhundertwende nahm die Hochschätzung des Rittertums allmählich ab. Walther bemerkt diese Veränderungen und beklagte sie in seiner sogenannten Elegie.
Walther von der Vogelweide · ca. 1170-1230
Owê war sint verswunden alliu mîniu jâr (Auszüge)
Owê war sint verswunden alliu mîniu jâr!
ist mir mîn leben getroumet, oder ist ez wâr?
...
liut unde lant, dârinne ich von kinde bin erzogen,
die sint mir worden frömde reht als ez sî gelogen.
...
Owê wie jæmerlîche junge liute tuont,
den ê vil hovelîchen ir gemüete stuont!
….
nû merkent wie den vrouwen ir gebénde stât:
die stolzen ritter tragent an dörpellîche wât.
(WvdV 124, 1-2, 7-8, 19-20, 24-25)
Linkadresse zu diesem Gedicht: www.lyrikmond.de/gedichte-thema-4-207.php#2634
Kommentar:
Worterläuterung:
gebénde (vorl. Zeile): von „binden“. Während die jungen Mädchen Blumenkränze im Haar trugen, kamen die verheirateten „unter die Haube“ (das Gebinde, ursprünglich ein Schleier, der durch ein Tuch über Kinn und Haar fixiert wurde), wie im Orient heute noch sehr verbreitet. Bei uns von den Ordensschwestern noch bis in die 60er Jahre gelegentlich getragen. Eine bekannte Darstellung ist zu sehen an der Figur der Uta im Naumburger Dom. Das gebénde verlieh den Frauen ein strengeres Aussehen, was zu den Vorstellungen der Minne wenig passte, weshalb der Schleier unter dem Band hervorgerupft wurde und dann aussah wie ein das Gesicht umrahmendes Kräuselband.
Hintergrund:
Die Gründe für die Abnahme der gesellschaftliche Hochschätzung des Rittertums sind wohl in erster Linie die folgenden:
1. Durch das Fürstenprivileg wurde dem Kaiser ein erheblicher Teil seiner Macht genommen. Dadurch sank automatisch auch das Ansehen und der Einfluss seiner ritterlichen Gefolgschaft. Die Vorstellung der Einheit eines „christlichen Abendlandes“ (Universalismus) begann allmählich zu verblassen. Die Ritter kamen sich geradezu degradiert vor.
2. Für die stetig steigende Anzahl der Ritter im 13. Jahrhundert stand dem Kaiser immer weniger Land zur Verfügung, um seine Gefolgsleute mit einem angemessenen Stück Land zu belehnen. Die Lehen waren schließlich so klein, dass eine Familie dadurch gar nicht mehr ernährt werden konnte. Wer damals noch Ritter wurde, war nur noch ein „armer Ritter“. Viele tauschten das Schwert mit dem Gänsekiel und wurden z.B. Landräte. Wer eine solche Verbürgerlichung seines Lebens nicht wollte, wurde wohl oder übel Raubritter.
3. Zu Beginn des 14.Jahrhunderts wurde die Armbrust entwickelt, deren Geschoss jedes Kettenhemd durchschlug. Die Ritter mussten nun Platten-Panzer tragen (Harnisch). Damit wurden sie so schwer und unbeholfen, dass sie sich nicht mehr selbsttätig in den Sattel schwingen konnten, sondern mit einem kleinen Kran hineingehievt werden mussten (welch erhabener Anblick). Wer jetzt vom Pferd stürzte, war eine leichte Beute für die Infanterie.
Zum Ende des 15.Jahrhundert machte schließlich folgendes Lied die Runde in Deutschland: „Ein neuer Orden durchzeucht alle Land mit Pfeifen und Trummen, Landsknecht sein sie genannt ...“
Walther ahnte nicht, dass die Entwicklung noch weiter gehen würde …. Wenn die jungen Leute ihre Väter und Großväter aus der frühhöfischen Gesellschaft erzählen hörten, dann fragten sie sich, wo diese damalige Stimmung geblieben war. Es gab sie noch, aber man fand sie jetzt eher bei den Bauern im Dorfe als an den ritterlichen Adelshöfen. Nach drei Generationen hoher Minne, Zurückhaltung, Trauer und Verzicht waren die Leute die „Hovetänzel“ wohl auch allmählich leid. Sie wollten statt zierlich zu schreiten auch einmal feste aufstampfen, statt sich immer artig zu verneigen, auch einmal herumspringen. Der bekannteste Dichter, der diesem Bedürfnis entgegen kam, war Neidhart:

Kommentar:
Eine Adaptierung ist hier leider nicht möglich, deshalb gleich eine Übersetzung:
Der Eppe zog dem Geppe sein Mädel Gumpe von der Hand;
dabei half ihm das Drohen mit dem Dreschflegel;
doch Meister Adelbert, der brachte die beiden auseinander.
Der ganze Streit ging um ein Ei, das Ruprecht gefunden hatte,
– ja das hatte ihm wohl der Teufel gegeben –
damit drohte er, Eppe zu bewerfen.
Eppe. der so zornig wie glatzköpfig war,
rief ohne Bedacht: Dann tu es doch, ich trotze dir.
Da warf ihm Ruprecht das Ei an die Glatze,
so dass es dem Eppe hinunter lief.
Man kann sich vorstellen, wie so etwas auf Leute vom Schlage Walthers wirken musste. Walther war entsetzt, Walther war empört:
Owê, hovelîchez singen,
daz dich ungefüege dœne
solten ie ze hove verdringen!
Daz die schiere GOT gehœne!
Der letzte Vers ist die stärkste Formulierung, die man bei Walther in seinen Kritiken finden kann. Er sucht nach Zustimmung von Gleichgesinnten, aber er steht auf verlorenem Posten:
Der uns fröide wider bræhte,
diu rehte und gefüege wære,
hei, wie wol man des gedæhte
swâ man von im seite mære!
Ez wær ein vil hovelîcher muot,
owê daz ez nieman tuot!
Schließlich resigniert er:
Frô Unfuoge, ir habt gesiget
Mädchenlieder
Obwohl in diesen Liedern kein Mädchen spricht, sondern Walther, ist der Adressat der Lieder ein Mädchen (keine Hohe Frouwe). Im eigentlichen Mädchenlied ist das lyrische Ich ein Mädchen (in den „uneigentlichen Mädchenlieder“ spricht dagegen Walther). Das ganze Lied ist im Grunde eine einzige Frauenstrophe.
Diesbezüglich ist „Under der Linden“ das herausragendste Lied, das fast an die deutsche Romantik gemahnt.
Schließlich finden sich Dichtungen, die man wohlverstanden als eigentliche Minnelieder bezeichnen kann. Ihnen eignet eine gewisse Leichtigkeit, und sie gelten heute als die Krone des dichterischen Schaffens Walthers. In diesen Liedern werden die dargestellten Liebesverhältnisse nicht reflektierend betrachtet, sie enthalten keine Trauer, keine Lobpreisungen und keine Belehrungen, sondern stellen das Verhältnis ganz (subjektiv) erlebnishaft dar.
Im folgenden Gedicht leistet Walther ein wahres Kabinettstückchen. Dem Minnesang liegt immer ein gerader Takt zu Grunde. Das bewirkt, dass diese Lieder oft dazu neigen, schwergewichtig und nachdrücklich zu wirken.
Ganz anders das folgende Lied, in dem es Walther gelingt, die Wirkung eines 3/4- bzw. 6/8-Taktes zu erzielen.
Jetzt ist das Frühlingsgedicht voller Lebhaftigkeit und Munterkeit. Inhalt und Form entsprechen sich in einzigartiger Weise.
Aber wie mag bei Walthers Zeitgenossen wohl ein Minnelied im 6/8-Takt angekommen sein?

Kommentar:
Worterläuterungen:
• vert (Vers 4) von faren/farn: vor sich gehen
• swar (Vers 7): wo
• niemen (Vers 8): niemand
• baz (Vers 12) : Adverb zu besser
• mê (Vers 13): mêre, mehr
• anger (Vers 15): eingezäunter Weideplatz im Dorf
• wâ (Vers 21): woher
• liebet (Vers 26): lieben = lieb machen; mit mir als Objekt
• gemeine (Vers 29): ganz allgemein
Auch dieses Lied ist voller Heiterkeit. Ganz typisch für Walther: Seine schalkhafte Bemerkung am Schluss.

Kommentar:
Worterläuterungen:
• was (Vers 2): bin
• gân (Vers 3): geben – Erinnern Sie sich: Man konnte ein Dienstverhältnis jederzeit auch aufkündigen. Dann verlör man allerdings auch die Fürsorge des Dienstherrn.
• enwizze (Vers 8): en=Verneinung, also: nicht weiß
• wes (Vers 8): Objekt Genitiv hier svw. „worüber“ (Bezieht sich das, was Walther bisher gar nicht gesagt hat)
• giht (Vers 10) von jehen; Gicht galt als eine Krankheit, die jemand einem durch einen Zauberspruch angehext hatte
Frage vorab: Inwiefern passen Zeile 1 und 2 nicht zusammen?
Das dürfte viele von Walthers Zeitgenossen einigermaßen gestört haben.
Die letzte Strophe macht ganz deutlich, dass es hier nicht um gesellschaftliches Ansehen (Ehre) geht, sondern um individuelle subjektive Gefühle.

Kommentar:
Worterläuterungen:
• frowe (Vers 1); Herrin
• maget (Vers 2): Mädchen
• triuwe (Vers 8): Treue
• gelich (Ver 10): gleich, gleichend
• dûhte (Vers 17): dünkte, schien
• buoz (Vers 28): Besserung
Wie schon im vorangegangenen Lied provoziert Walther auch hier mit der Gleichsetzung von Frouwe und Maget, ja wenn man die die Zeile
„und nim dîn glesîn vingerlîn
für einer küneginne golt.“
betrachtet, ist es noch mehr als Gleichsetzung.
„Sie verwîzent mir daz ich
ze nidere wende mînen sanc.“
Es kam damals sogar als Gegenbegriff zur Hohen Minne das Wort von der „Niedere Minne“ auf.

Kommentar:
Worterläuterungen:
• frowelîn (Vers 1): Mägdelein
• hiute (Vers 2): heute
• willeclîchen (Vers 4): rechten
• verwizent (Vers 8): verübeln
• undanc (Vers 10): Nachteil
• gâch (Vers 14): jäh, schnell
• glesîn vingerlîn (Vers 24): gläserner Ring
Am Schluss kommt das wohl berühmteste Lied Walthers. Es hat im Grunde keinen Adressaten, es soll ja auch niemand davon wissen.
Das ist ein völlig neuer Stil, neuer Ansatz, den Walther hier schafft. Der Text ist in seiner Struktur wie Gedichte, wie sie etwa seit der Klassik als „Erlebnislyrik“ bekannt sind. So erinnert Walthers Text etwa an Mörikes „Früh, wenn die Hähne krähn“ (wobei dort die Stimmung allerdings völlig entgegengesetzt ist). Walther war also seiner Zeit um 500 Jahre voraus.
Der Text ist keine Mitteilung, keine Information, sondern er ist „monologisch“ eine subjektive Erinnerung, wie eine Tagebucheintragung eines Mädchens. Walthers Lieder, die (mehr oder weniger) in diesem nicht an eine „frouwe“ adressierten Stil verfasst sind, bezeichnet man deshalb auch als „Mädchen-Lieder“.

Kommentar:
Worterläuterungen:
• gebrochen Bluomen (Vers 6): Das ist die exakte Übersetzung des lateinischen „deflorare“.
• schône (Vers 9): schön
• hêre frowe (Vers 14): Ausruf der freudigen Überraschung; als (wie eine) h. f., Interjektion
• tuzentstunt (Vers 16): tausend mal; „stunt“ nicht in der Bedeutung wie lange, sondern wie oft
• des (Vers 22): Objekt-Genitiv, der im mhd. oft gebraucht wurde
• inneclîche (Vers 23): innig; innerlich
• nu enwelle got (Vers 30): etwa: das verhüte Gott
• bevinde (Vers 33): herausfinden
• getriuwe (Vers36): hier: verschwiegen
Nachwort:
Die Minnesänger haben uns so manches Gedicht hinterlassen, das solchen aus der Neuzeit inhaltlich und formal in nichts nachsteht. Zwar erscheint die alte Sprache uns Heutigen fast wie eine Fremdsprache, aber wer Englisch, Französisch oder gar Latein gelernt hat, wird sich wohl auch ins Mittelhochdeutsche hineinfinden.
Es gibt aber auch Hinterlassenschaften, die uns keinerlei Verständnisschwierigkeiten bereiten. So weiß man auch heute noch „Ritterlichkeit“ und „Höflichkeit“ zu schätzen. Vom munteren Schlagetot und Weiberschänder haben sie sich im Laufe ihrer Geschichte schließlich zu Verehrern der Weiblichkeit und Verteidiger der Schwachen gegenüber den Stärkeren entwickelt („Schildesamt“).
Was auch immer die Mächtigen „im Schilde führten“, die Schwachen konnten darauf vertrauen, dass sie nicht „im Stiche gelassen“ wurden und dass man jederzeit bereit war, für sie „eine Lanze zu brechen“, um die Stärkeren „in die Schranken“ zu weisen. Damit hatte die Ritterschaft das Fundament für unsere heutigen Werte gelegt.
Dieter Effertz